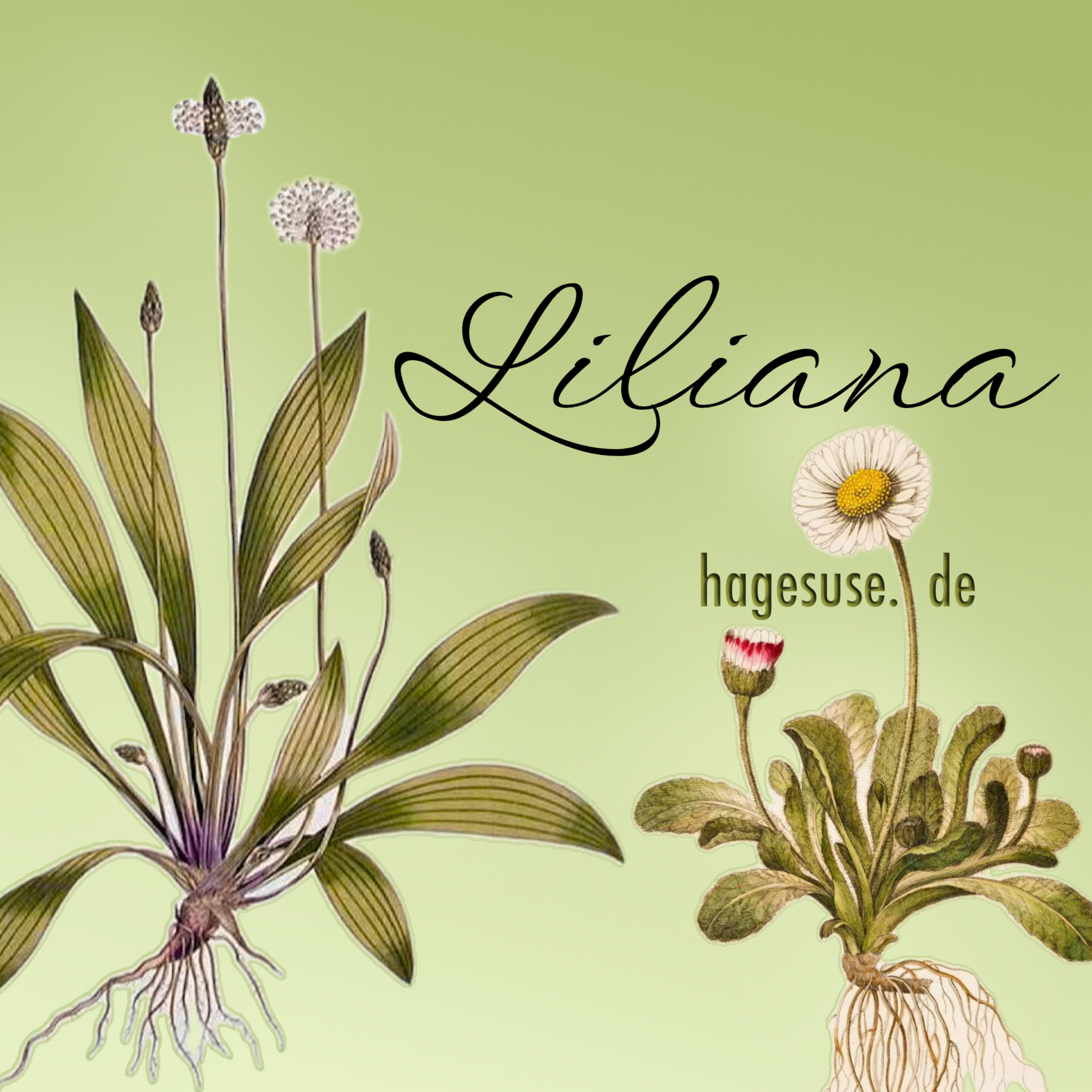Manchmal tut es fast körperlich weh, wenn um mich herum etwas ungerecht oder unfair ist. Wahrheit und Gerechtigkeit sind für mich keine bloßen Werte – sie sind Grundbedürfnisse. Doch mit meiner direkten Art ecke ich oft an. Ich weiß, das ist typisch neurodivergent: Wir sprechen Dinge aus, die andere lieber unausgesprochen lassen. Wir benennen, was schief läuft, oft ungefiltert, manchmal zu direkt – nicht, weil wir verletzen wollen, sondern weil Unwahrheit und Ungerechtigkeit sich anfühlen, als würde etwas in uns selbst falsch stehen. Es ist körperlich spürbar.
In solchen Momenten erinnere ich mich an einen alten Philosophen, der schon vor über 2.000 Jahren versuchte, Menschen zum Nachdenken zu bringen – Sokrates, dieser charmante, unbequeme Schelm.
Sokrates war ein Mann, der viele Fragen stellte – so viele, dass die Leute manchmal ganz durcheinander wurden. Er glaubte, dass man die Wahrheit nicht einfach gesagt bekommt, sondern dass man sie selbst entdecken muss, indem man nachdenkt und fragt.
Er streifte barfuß durch die Straßen Athens, sprach mit Händlern, Soldaten und Schülern und fragte: „Was ist Mut?“ – „Was ist Gerechtigkeit?“ – „Was bedeutet Freundschaft?“ Dabei wollte er nicht bloß klug wirken, sondern den Menschen helfen, selbst klüger zu werden.
Sokrates hat nichts aufgeschrieben. Alles, was wir über ihn wissen, stammt von seinen Schülern – besonders von Platon, der seine Gespräche festhielt. Doch nicht alle mochten, dass Sokrates so viele Fragen stellte. Manche fühlten sich durch ihn bloßgestellt oder herausgefordert. Am Ende wurde er vor Gericht gestellt, weil man sagte, er würde die Jugend „verderben“, also zum eigenständigen Denken anstiften. Er wurde zum Tode verurteilt – und trank schließlich freiwillig einen Becher mit Gift (Schierling).
Doch seine Gedanken leben bis heute weiter. Sein berühmter Satz war:
„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
Damit meinte er, dass man nie aufhören sollte, neugierig zu sein und Fragen zu stellen – egal, wie alt man ist. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum seine Lehren heute noch so aktuell sind. Denn ehrlich gesagt: Unsere Gesellschaft liebt brave Mitläufer mehr als freie Denker. Kinder, die zu laut fragen oder zu lebendig träumen, gelten schnell als Störenfriede – dabei sind sie oft einfach nur mutiger, kreativer oder sensibler als andere. Im Schulsystem sollen alle gleichzeitig das Gleiche lernen. Wer aus der Reihe tanzt, wird korrigiert. Und später im Berufsleben heißt es dann plötzlich, man solle selbstständig denken, kreativ sein und neue Ideen einbringen. Verrückt, oder?
Eine der bekanntesten Geschichten, die man Sokrates zuschreibt, ist die von den drei Sieben:
Ein aufgeregter Mann kam zu einem Weisen gerannt. „Ich muss dir etwas erzählen! Dein Freund …“
„Halt!“, unterbrach ihn der Weise.
„Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt?“
„Drei Siebe?“, fragte der Mann erstaunt.
„Richtig – drei Siebe. Das erste Sieb ist das der Wahrheit. Ist das, was du mir erzählen willst, wahr?“
„Ich habe es nur gehört, man sagte mir …“
„Nun gut. Dann prüfen wir das zweite Sieb – die Güte. Ist das, was du mir sagen willst, wenigstens gut?“
„Nein, im Gegenteil …“
„Dann bleibt das dritte Sieb – die Notwendigkeit. Ist es wichtig, dass du mir das erzählst?“
„Eigentlich nicht unbedingt.“
„Also mein Freund“, lächelte der Weise, „wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, warum willst du es dann überhaupt sagen?“
Man sagt, Sokrates habe einst gefragt, bevor man spricht:
Ist es wahr?
Ist es gut?
Ist es notwendig?
Für viele neurodivergente Menschen ist das ein ständiger innerer Konflikt. Denn das Bedürfnis, Dinge zu benennen, Missstände aufzuzeigen oder einfach laut zu denken, ist tief verankert. Wahrheit ist für viele von uns keine Entscheidung – sie ist ein Zwang, eine körperliche Notwendigkeit. Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit tun weh.
Das erste Sieb, die Wahrheit, ist für autistische Menschen meist selbstverständlich: Sie sehen sie, spüren sie, und sie können sie schwer ignorieren. Doch Wahrheit allein kann manchmal rau klingen. Hier hilft das zweite Sieb – die Güte: Nicht, um sich zu verstellen, sondern um Worte so zu wählen, dass sie gehört werden. Güte bedeutet nicht, die Wahrheit zu verschweigen – sondern sie in einer Form zu kleiden, die Türen öffnet, statt sie zuzuschlagen. Und das dritte Sieb, die Notwendigkeit, erinnert uns: Nicht jede Information muss ausgesprochen werden – selbst wenn sie wahr und gut gemeint ist. Bei ADHS fließen Gedanken oft unaufhaltsam; das Sieb der Notwendigkeit wird da schnell durchlässig. Doch manchmal darf ein Gedanke auch einfach sein, ohne geteilt zu werden – auch wenn das schwer auszuhalten ist. Denn zwischen Wahrheit und sozialer Verträglichkeit zu balancieren, fühlt sich manchmal an, als müsste man einen Sturm in ein Glas Wasser sperren.
So werden die drei Siebe nicht zu einer Einschränkung, sondern zu einem Werkzeug der Selbstfürsorge. Sie helfen, die eigenen Impulse zu ordnen, ohne sich zu verbiegen. Denn wer neurodivergent kommuniziert, tut das nicht aus Belanglosigkeit – sondern aus einem tiefen Bedürfnis nach Authentizität, Gerechtigkeit und Verbindung.
Aber das beste Werkzeug taugt nichts, wenn man es im entscheidenden Moment vergisst – oder wenn das Herz lauter ist als die Vernunft.
Und vielleicht ist genau das der Punkt: Wir müssen nicht immer perfekt sieben. Manchmal reicht es, wenn wir uns bewusst entscheiden, wann wir sprechen – und wann wir einfach atmen.